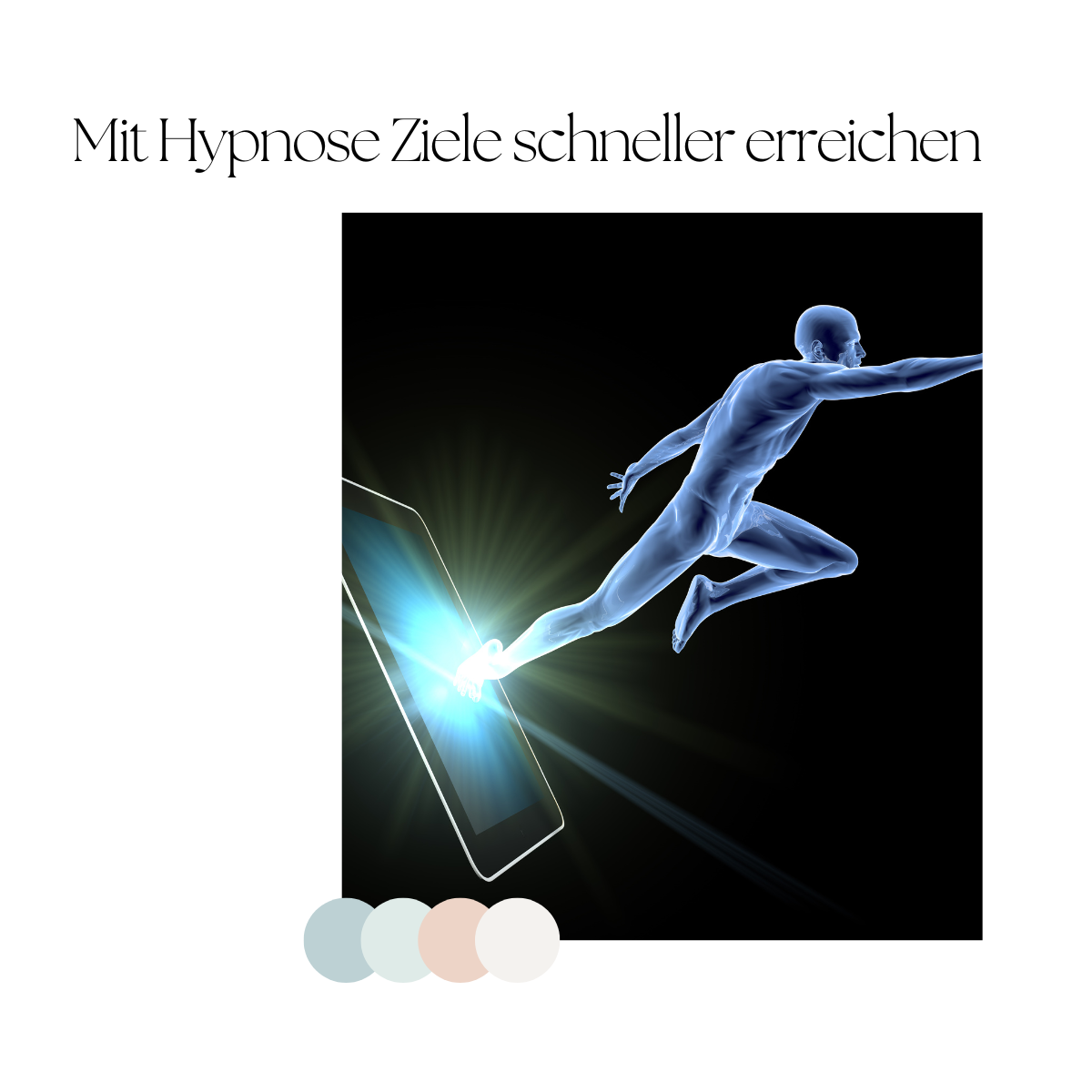
Hypnose als komplementäres Instrument in der Psychotherapie
von Bettina Rodowski – 24. September 2025Als praktizierende Hypnosetherapeutin beobachte ich regelmäßig, dass Patient:innen, die über lange Zeit rein psychotherapeutisch behandelt wurden, häufig in ihren Veränderungsprozessen stagnieren — nicht, weil psychotherapeutische Verfahren per se untauglich wären, sondern weil verdrängte, stark emotional geladene Inhalte in verbalen Sitzungen oft nur schwer zugänglich bleiben.
Vor diesem Hintergrund prüfe ich Hypnose aus wissenschaftlicher Perspektive als ergänzende Methode: Welche neurobiologischen Mechanismen erklären ihre Wirkung, und wie belastbar ist die klinische Evidenz für spezifische Indikationen.
Wissenschaftliche Befunde und neurobiologische Mechanismen
Neuroimaging- und EEG-Studien zeigen konsistent, dass hypnotische Zustände mit Modulationen dreier Kernnetzwerke einhergehen: dem Default-Mode-Netzwerk (DMN), dem Salienz Netzwerk und exekutiven Kontrollnetzwerken. Unter Hypnose kommt es häufig zu einer Reduktion DMN-bezogener Selbstreferenz und zu veränderter Konnektivität zwischen Salienz- und Exekutive Netzwerken — Befunde, die die berichtete, erhöhte fokale Aufmerksamkeit bei gleichzeitig emotionaler Distanz erklären können.
Klinische Wirksamkeit: Metaanalysen und Indikationen
Aktuelle Meta-Analysen berichten über kleine bis große Effekte der Hypnose bei verschiedenen somatischen und psychischen Problemen; besonders robust ist die Evidenz für schmerzhafte Zustände und perioperative Anwendungen, während Befunde zu posttraumatischen Belastungsstörungen und traumabezogenen Interventionen ebenfalls positive Effektgrößen zeigen. Eine 20-Jahres-Metaanalyse fast breit, dass signifikante Effekte vor allem bei Schmerzpopulationen und in medizinisch-proceduralen Kontexten auftreten. Parallel belegen spezifische Arbeiten große Effektstärken hypnotherapeutischer Techniken bei traumatischem Stress.
Interpretation im klinischen Kontext
Die neurobiologischen Daten liefern ein plausibles Modell: Hypnose schafft einen Zustand, in dem die kritische Bewertung abgeschwächt und fokussierte Aufmerksamkeitsprozesse verstärkt sind — ein Rahmen, der kontrollierten Zugang zu episodischen und emotionalen Gedächtnisinhalten erlaubt, ohne die retraumatisierende Flut affektiver Reaktionen, die in offenen Gesprächen oft blockierend wirkt. Klinisch erklärt dies, weshalb bei geeigneter Indikation und sorgfältiger Technik bei einigen Klient:innen bereits wenige Sitzungen
substanzielle Veränderungen bringen können. Wichtig bleibt jedoch: Studienlage und Effektstärken variieren je nach Indikation, Studienqualität und angewandter Methodik.
Ethische und methodische Grenzen
Trotz positiver Befunde sind Grenzen und Risiken klar zu benennen: methodische Heterogenität, mögliche Suggestibilität-Effekte und das Risiko entstehender Fehl- oder Scheinerinnerungen bei unsauberer Technik. Deshalb erfordert die Einbettung hypnotherapeutischer Verfahren in die Psychotherapie standardisierte Indikationsstellung, transparente Informed-Consent-Prozesse und Fachausbildung sowie die Kombination mit etablierten psychotherapeutischen Nachsorgeformaten.
Fazit:
Aus meiner Sicht ergänzt Hypnose die Psychotherapie durch einen neurobiologisch plausiblen Zugang zu schwer erreichbaren, emotional aufgeladenen Inhalten und zeigt für bestimmte Indikationen belastbare klinische Effekte. Wissenschaftlich fundierte Anwendung, klare Indikationskriterien und Qualitätssicherung sind jedoch Voraussetzung, damit Hypnose ihr therapeutisches Potenzial sicher und nachhaltig entfalten kann.